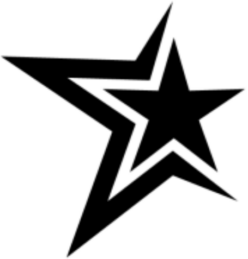hier unterscheide ich einfache akkorde, die nur die sieben vorhandenen töne einer klassischen tonleiter verwenden und reine akkorde, die auf die zugehörigen intervalle aufgebaut sind und gleichzeitig vermutlich den grundakkord einer dazugehörigen tonleiter bilden.
nach der theorie werden akkorde gebildet durch zwei aufeinanderfolgende intervalle von terzen. das intervall einer terz umfasst drei oder vier halbtöne. entsprechend der reinen mollterz, aus 1/6 – drei halbtöne vom grundton entfernt, und der reinen durterz aus 1/5 – entsprechend vier halbtöne vom grundton entfernt.
die kleine terz umfasst also drei halbtöne auf der klassischen skala mit 12 stufen, die große terz vier halbtöne.
da die klassik erstmal nur dur und moll unterscheidet, ist ein akkord der aus einer großen terz gebildet wird gefolgt von einer kleinen ein dur akkord, während akkorde aufgebaut aus einer kleinen terz gefolgt von einer großen in moll erklingen.
alle reinen akkorde werden auf der zwölftonskala diesem modell nach durch einfaches abzählen gebildet.
wir gehen davon aus, dass schwarze und weiße tasten gleichwertig sind und der abstand zweier benachbarter tasten immer einen halbtonschritt umfasst. so zählen wir einfacherweise von c ausgehend alle schwarzen und weiße tasten aufwärts spielend bis zum nächst höheren c‘ die zwölf halbtonschritte, die in diesem system maßgeblich sind.
es fällt auf, dass an zwei stellen, sowohl zwischen e und f als auch zwischen h und c‘ keine schwarze taste zu finden ist und also zwei weiße tasten direkt nebeneinander liegen. diese abstände umfassen ebenfalls halbtonschritte. es sind die halbtonschritte der c-dur oder a-moll tonleiter, je nachdem von welchem der beiden grundtöne aus ein pianist spielt, liegen die a-moll bzw. die c-dur tonleiter vollständig auf allen weißen tasten. diese anordnung wurde also einzig aud der überlegung gewählt, dass diese beiden tonleitern die zugänglichsten und natürlichsten sind, sehr häufig verwendung finden und daher am einfachsten zu erreichen sein sollten. die unterteilung in schwarze und weiße tasten aus platzgründen stellt darüber hinaus keine wertigkeit dar, zwischen jeder vorhandenen taste liegt ein gleichwertiger halbtonschritt.. zumindest nach dem theoretisch entwickelten ideal der klassischen musik auf der skala mit zwölf halbtönen.
von einem gefälligen grundron ausgehend wie a oder c oder fis oder einem anderen, werden reine dur akkorde gebildet, indem wir von diesem grundton aus vier halbtöne nach oben gehen und von diesem zweiten ton aus nocheinmal drei halbtöne weiter. alle drei töne zugleich angeschlagen oder nacheinander bilden die grundlage für diesen akkord. er heißt von c aus c dur akkord von a aus a dur und von fis aus entsprechen fis dur akkord.
dadurch erhalten wir 12 dur akkorde, die den grundakkord einer jeden dieser zwölf dur tonleitern bilden. es ist möglich den grundton in der nächsthöheren oktave mit anzuschlagen, wodurch sich aus vier tönen noch vollere klänge bilden.
die reinen mollakkorde werden genauso gebildet mit dem unterschied, dass hier die große terz auf die kleine terz folgt.
wir gehen also von einem unserer zwölf grundtöne aus erst drei halbtonschritte nach oben und dann von da aus nocheinmal weitere vier halbtonschritte. dadurch erhalten wir zwölf moll akkorde, die wiederum den grund akkord der entsprechenden moll tonart bilden.
insgesamt liegen nach dieser theorie praktisch 24 unterschiedlich zu benennende reine akkorde vor.
—-
haben wir uns im wesentlichen sinne für eine der sieben möglichentonleitern endschieden und unseren grundton zu dieser skala gefunden, stehen für jede oktave nur sieben der zwölf möglichen töne zur verfügung. einfacherweise für c-dur oder a-moll sämtliche weiße tasten ohne eine der schwarzen.
wir zählen von c nach c‘ genau sieben tonschritte, welche fünf ganztonschritte und zwei halbtonschritte enthalten.
in diesem rahmen ist es nicht möglich zu allen sieben enthaltenen tönen einen reinen akkord zu bilden.
wir gehen vom gewählten ton aus nun zwei schritte innerhalb dieser skala nach oben vom ersten bis zum dritten darauf folgenden ton. sehen wir, dass diese sprung nicht zwei ganztonschritte sondern einen ganzton und einen halbtonschritt enthält, vergrößern wir den abstand um einen weiteren ganztonschritt, um einen dur akkord zu erhalten, und gehen von da aus so oder so noch einmal zwei schritte weiter. so erhalten wir den dreiklang, der die grundlage für diesen akkord bildet. auch hier ist es möglich den ersten ton in der nächst höheren oktave zu wiederholen bzw. alle vier töne gleichzeitig anzuschlagen.
für die molltonleiter erscheint es sinnvoll im falle dass die erste kleine terz nicht drei sondern vier halbtöne enthält nicht diese zu verkleinern, sondern die zweite terz des akkordes entsprechend um einen weiteren schritt zu vergrößern, um durch die verhältnismäßigkeit den mollcharakter wiederherzustellen.
—-
bilden wir aus den oben vorgestellten terzen dreiklänge, indem wir jeweils zwischen zwei tönen einen ton frei lassen, so ergeben sich in jeder tonleiter drei reine durakkorde und drei reine mollakkorde sowie ein dissonanter akkord, der aus zwei gleichen terzintervallen zusammengesetzt sind.
die passenden akkorde zum definierzen modus in der entsprechenden tonart liegen auf dem grundton, auf der quarte und auf der quinte.
[aus allgemeinen quellen]