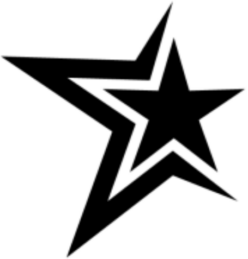jede violine, auch die teuerste und beste, muss dem künstler und seinen gegebenheiten angepasst werden, deshalb ist ein neues klassisches instrument am besten und eigentlich grundsätzlich nur in vorgefertigtem zustand erhältlich. das ist auch so bei meinem anspruchslosen spielzeug aus sperrholz mit nitrolackierung.
vorgefertigt heißt, dass alles in bester ordnung ist, was das instrument selbst angeht, alle austauschbaren oder beweglichen teite sind aber neutral und nur grob vorgeformt. die seele, also der soundpost, ist in einer neutralen stellung, die allgemein vom hersteller selbst als ideal betrachtet wird, der steg ist roh oder grob zugeschnitzt und damit auch in neutralem zustand, der sattel ist für die saiten leicht vorgeritzt, alle vier bohrungen, in denen die wirbel stecken, haben die ideale anfangsgröße und die wirbel selbst sind beliebig eingesetzt, also jetzt noch vertauschbar, das kleine loch in jedem der wirbel für die anfänglichen stahlsaiten ist möglichst klein und so weit wie möglich am rand, damit sie den eigentlichen löchern weiter mittig, die noch fehlen, nicht im weg sind, die ersten saiten sind also dünn und neutral, nicht wertlos aber eher nur representativ, sie eignen sich zum ersten bespielen und für ein erstes kennenlernen, müssen aber nicht zwingend die besten saiten sein.
auch ein erster bogen ist bei einem neuen set wie meinem mit frischem haar, ungespannt und mittelmäßig ausgewogen, etwas möglichst durchschnittliches, das bald ergänzt werden sollte durch einen vernünftigen bogen.
es gibt also eine menge zu tun und ein bisschen zeit zu investieren, bevor das routinerte spiel erst beginnt oder das üben, mensch und instrument müssen erst eins werden, dabei ist es nicht nötig alles gleich sofort anzugehen, bevor sich der erste kontakt zu einem bleibenderen eindruck entwickelt, und ein umtausch, ein wechsel nichtmehr zur frage steht.
wer es sich leisten kann, nimmt mehrere modelle der gleichen fabrikation in die hand und wählt nach empfinden das naheliegendste aus, weil auch identische fabrikware von stück zu stück unterschiede hat, die sich charakteristisch entwickeln und erstrecht etwas aus der manufaktur, sei – sie – nun von einem gesellen, gar einem meister um die ecke oder aus china.
klar ist, dass instrumente aus massivholz auch klimatisch bedingten schwankungen unterliegen, und ich habe grundsätzlich instrumente aus asien erstmal vom oberen lack befreit sowie mit decke und hals auseinadergebaut, das holz atmen lassen und es dann – nach einer ganzen zeit – wieder zusammengefügt, man kann das kaum beschleunigen über wenigstens einen wechsel der jahreszeit im gewohnten räumlichen klima, also schon sechs bis acht wochen – heizen, lüften wie gewohnt bei unterschiedlicher temperatur und luftfeuchtigkeit. die gewöhnung des holzes and den ersten jahreslauf im üblichen gebrauch, dem eigenen musikalischen leben, ist eine ziemlich sensible angelegenheit, die sache wird von jahr zu jahr leichter, das holz robuster, auch im freien einsetzbar und der umgang vertraut.
das wirklich wertvolle an einer geige ist also nicht nur das holz und seine verarbeitung, sondern die individuelle anpassung, wenn du dafür einige hilfe brauchst, kann das extrem teuer werden, ein gebrauchtes instrument ist daher um einiges leichter zum einstieg als ein neues, wenn es aus geübten händen kommt und zur eigenen persönlichkeit passt, ist eine neuanschaffung komplett unnötig.
deshalb stellen sich zu anfang viele fragen, wie – lohnt sich etwas aus echtem holz, oder ist das leben im punkrock nicht für allzu zarte gegenstände geeignet. wenn sich erstmal was eingespielt hat, hab ich keine lust mit was vll. besserem wieder von vorne anzufangen, gerade in meinem alter ist etwas, das sich einmal bewährt auch langfristig gut, selbst etwas zu anfang minderwertiges.
ich fange schließlich schon das dritte instrument an, und darf mich mal festlegen. meine aktuelle lebenssituation erlaubt dabei schonmal nichts wertvolles, nichts großes, nichts sensibles sowieso, aber etwas unproblematisches unbedingt. das sperrholz ist dabei ein absoluter vorteil, das ist zwar nicht so edel wie tonholz, sorgt aber in der industriellen herstellung für einen präzisen klangraum, der bei hitze, lärm und hoher luftfeuchtigkeit weniger schwankungen unterliegt ;)
mit sperrholz, ist dann bei mir auch der soundpost strammer, worunter weiche fichte gern leidet, so kann er auch bei temperamentvollem gebrauch nicht verrutschen oder gar umkippen, dazu komme ich aber viel viel später, wenn ich auch die wahl der saiten getroffen hab.
für jeden anfang und überhaupt im dauernden gebrauch empfehle ich folgende grundausstattung, die vll. sowieso schon so normal ist wie für jeden raucher ein feuerzeug.
- ein kleines handtuch oder einen ähnlich weichen stoff, der im koffer platz findet, als schultertuch und als abdeckung.
- ein stück rohseide, baumwolle oder wollstoff zum abwischen des kolophoniumstaubes, zum reinigen der saiten usw. aber auch als dämmstoff für das zusatzfach mit dem kolophonium, das würde beim klappern nämlich schnell kaputtgehn.
- einen weichen b oder mittleren bleistift hb nicht nur für notitzen, das graphit der miene dient als gleitmittel beim einstimmen der saiten.
- ein kleines stück seife aus glycerin als gleitmittel für die stimmwirbel, es gibt unterschiedlich rutschige seifen, je nach saitenart wird sich was passendes finden.
- ein stück kreide um die von der seife gleitenden wirbel nach bedarf wieder zu hemmen, besonders bei stahlsaiten.
- ein stück kolophonium, aus einem der unterschiedlichen härtegrade für nylon, darm oder stahlsaiten und entsprechend dem eigenen geschmack, was klang und lautstärke angeht.
- ein kleines und sehr scharfes schnitzmesser um die wirbel anzupassen, den steg zu formatieren und den bleistift zu spitzen, auch zum anpassen eines individuellen sondpost geeignet und zum anpassen des sattels an die spielart und typische saiten.
—
ja, das wars, was eigentlich nie fehlen sollte, mehr für etwas kniffelige arbeiten benötigt jeder anspruchsvollere geigenkasten einen stimmsetzer, das ist ein bestimmtes werkzeug für den soundpost, falls der mal umfällt, was nicht passieren sollte, aber vor allem um ihn dahin zu rücken, wo er am besten für den richtigen sound sorgt oder um gleich einen passenden neuen zu setzen. die richtige position zu finden kann eine ganze weile dauern und oft variieren, bis sich das ganze im viertel millimeterbereich einpendelt. wer sich das nicht zutraut ist gut beraten die finger davon zu lassen, allerdings kostet ein handwerker, der das mehr auch nach seinem eigenen geschmack beginnt in einer mehrstündigen session zusammen mit dem musiker soviel wie eine ganze geige mittlerer klasse, und die kleinste erschütterung wird vor einem wichtigen konzert zur gefühlten katastrofe. das sind probleme, die normale menschen kaum nachvollziehen können. einfach ist doch immer am besten.
was dann leider doch etwas umständlich ist, aber wohl nötig wird, ist ein bohrer, der etwas mittiger entsprechende löcher für die ausgewählten saiten ermöglicht, dass muss schon sein, allein um das holz im wirbelkasten durch die saite nicht zu beschädigen. manche nylonsaiten können auch für helle klänge ungewöhnlich dick sein und kaum durch das loch passen, einfache stahlsaiten sind regelmäßiger und dünner, es gibt auch sehr kräftige möglichkeiten, vor allem darmsaiten umsponnen noch im rahmen oder narürlich, sind deutlich dicker als der durchschnitt und passen auf keinen fall auch nur im traum durch die gewöhnlichen löcher, auch hier sind die helleren klänge nicht unbedingt durch einen kleineren querschnitt gekennzeichnet sondern eher durch härte und spannkraft, ähnlich vollem und hartem material des heller klingt als weiches oder dünnes, wohl beim schwingen auch abhängig von der masse, deshalb sind sie auch mit kupfer, blei, gold, silber und leichtmetallen umwickelt. ähnliches gilt für die noch selteneren saiten aus seide. auf seide, stahl und naturdarm greift aber immer leicht auch der bogen mit passendem kolophonium, nylon muss mit metall überzogen sein, was bei der dünnen e saite noch nicht geht, deshalb ist sie heute fast immer aus stahl.
was gerne verwendet wird, aber absolut zu vermeiden ist, ist schleifpapier, auch wenn die verlockung groß ist, und auch wenn das tatsächlich von so genannten fachkräften praktiziert wird, diesen banausen ist nicht zu trauen, holz wird im geigenbau niemals geschliffen, das ist absolut tabu aus vernünftigen gründen. geschliffen wird nur lack, und nur um ihn weiter aufzubauen, falls das mal thema sein sollte, besonders schellack wird gefühlt tausendfach aufgetragen und geschliffen – als ein qualitätsmerkmal, dabei verwandelt sich mehr materie in staub als in die fertige lackschicht. entfernt wird lack dagegen niemals mit schleifpapier sondern mit dem zieheisen, auf keinen fall darf schleifpapier irgendwo das holz verletzen, dazu gilt es mit dem cutter oder schnitzmesser vorsichtig zu kratzen, zu schaben oder möglichst genau zu schneiden, was um ehrlich zu sein schwieriger aussieht als es letztendlich ist.