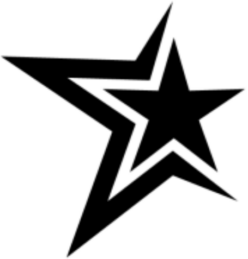als istrument dient eine bratsche mit relativ niedriger saitenlage und bezogen mit gitarrensaiten aus stahl in der stärke 10-11
von einem solchen satz für gitarre, bestehend aus sechs stahlsaiten, entfernen wir die beiden e-saiten und erhalten ein 4rer set bestehend aus den saiten h, g, d, a.
wichtig ist, es ergeben sich zwei paare, jeweils eines blank, das andere umsponnen, ein typisches merkmal dieser fiktionalen zigeunergeige.
durch die verkürzung auf die mensur der bratsche, lassen sich mit ein wenig geschick die reinen quinten der klassischen bratsche stimmen, das ist aber nicht das eigentliche ziel.
die erscheinung zweier paare spiegelt sich im stimmungsmuster wieder, die reine quinte gilt als lächerliches klassisches ideal und wird ersetzt durch eine unreine übermäßige quinte, einem as ähnlich einer kleinen sexte der aeolischen molltonart.
die zigeunerquinte für die stimmung der bratsche entspricht also einer aeolischen sexte.
der grundton der vierten, also tiefsten saite ist und bleibt das natürliche c von 128 Hz.
von da aus folgt die unreine, übermäßige quinte auf ein aeolisches as.
da unser set mit zwei paaren ausgestattet ist, wiederholt sich dieses muster wie auf den beiden umsponnenen saiten, genauso auf den beiden blanken.
der grundton ist das natürliche c‘ von 256Hz – die übermäßige quinze das aeolische as.
zwischen diesem parallelismus liegt eine reine große durterz von einem as auf das c‘ von exakt 256Hz. die durterz entspricht der reinen terz aus der harmonik mit naturtönen also ist 1 /5 der saitenlänge des as.
gespielt wird eine tonleiter wie beschrieben im vorigen artikel.
(c) des / e, f / g, as / b
das b ist ein etwas höherer halbton unter dem h, also ein hes. es ist nur ein klein wenig höher und kann als normaler halbton b oder auch hes gespielt werden.
der absolut statische ton ist das c’256Hz, die restlichen töne sind variabel, dieses c jedoch darf nur mit 256Hz intoniert werden.
ebenso der ausgelassene grundton c 128Hz.
1. = das des liegt bei einer frequenz von ca.136Hz
2. = das e ist wesentlich höher und liegt um 163Hz.
3. = in relativ gewöhnliches f von 171Hz.
4. = das g mit 192Hz.
5. = ein as um 204Hz.
6. = das b mit ca. 228Hz
7. = und ein c’256Hz.
das ist die untere tonleiter. die obere tonleiter verläuft entsprechend ähnlich mit dem unterschied, dass diese über 8 töne verfügt, da der grundton von c’256Hz vorhanden ist und in der oktave mit möglichst exakt 512Hz erklingt.
umgegriffen wird auf die nächste saite über das b, wodurch das folgende c‘ als grundton von der leeren saite erklingt, da dieser ton die funktion des leittones erfüllt, ist das spielen der freien saite legitim, was sonst unter allen umständen zu vermeiden ist!
der sprung auf das blanke saitenpaar erfolgt durch das intervall reine durterz in der höheren lage, wodurch die klingende saite verkürzt wird, was bei den dünneren saiten und höheren tönen zu einem definierteren und klareren klang führt. dagegen ist der klang der tieferen saite voller, wenn sie in größerer länge erklingt. es erfolgt also ein lagenwechsel beim wechsel von den umsponnenen auf die blanken saiten und umgekehrt.